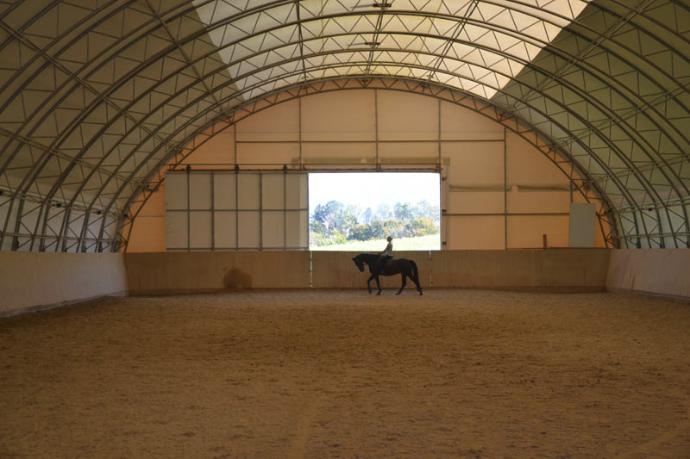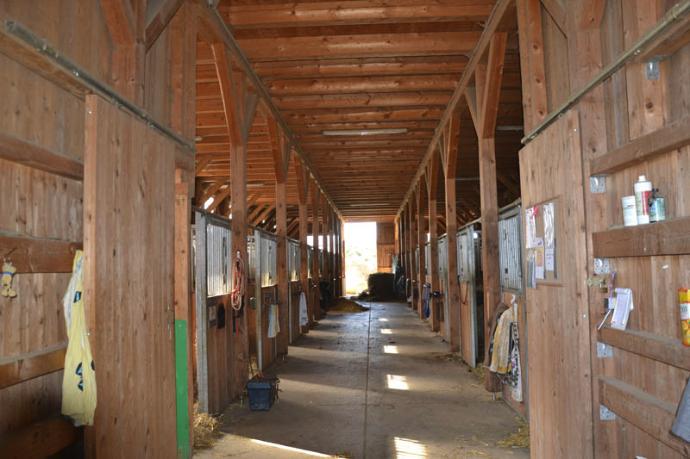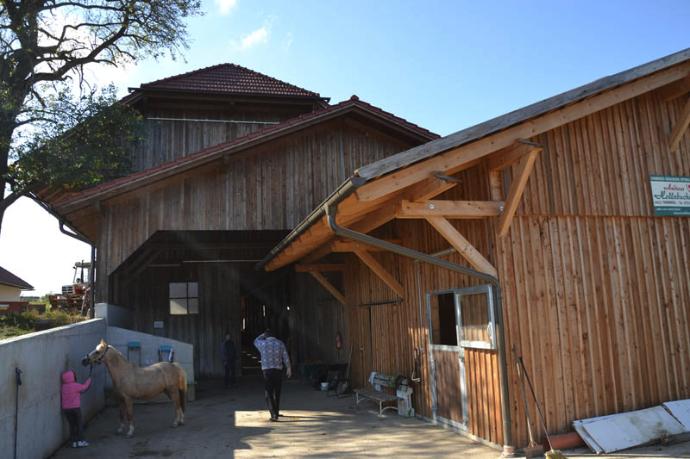Reiter- und Ponyhof
Garsten
vulgo "Kleineder"
Betriebliche Eckdaten
90 ha bewirtschaftete Fläche (davon 30 ha Pachtgrund)
Mietwohnungen
Reiterhof
Motivation: Was war der Ausgangspunkt bzw. die Überlegungen für das Veränderungsvorhaben?
Anfang der 90er Jahre standen Friederike und Franz vor der Entscheidung,
ob sie, aufgrund des desolaten Zustandes des Hofes, das „Kleineder“
gleich wegreißen oder doch etwas damit „anfangen“ sollen. Ersteres haben
sie nicht übers Herz gebracht, aber dass es zu einem
Vorzeige-Reitbetrieb wird, war zu diesem Zeitpunkt auch nicht absehbar.
Intention: Was wollten Sie damit erreichen und wie funktionierte die genaue Umsetzung? Was wurde gemacht? Was waren die Holpersteine? Was gibt es zu beachten, wenn man etwas Ähnliches machen möchte?
Manche Dinge ergeben sich im Leben eben einfach so. Zuerst wurden im
Zuge der Renovierungsarbeiten zwei Mietwohnungen gebaut. Ein Mieter
wollte ein Reitpferd halten und so wurden die ersten beiden Boxen in
Stand gesetzt. Friederike und Franz haben sich damals gedacht, sich auch
ein Pferd zu kaufen, denn das eine sollte nicht so alleine sein. Nach
und nach kamen dann Einstellplätze dazu und so bietet der Hof heute
Platz für 50 Pferde. 2004 wurde dazu ein eigenes Stallgebäude aus Holz
unterhalb des Hofes errichtet.
Die 2007 errichtete Reithalle weist
auf Grund ihrer Bauart und Form auch einige Besonderheiten auf. Eine 72
mal 22 Meter große Rundbogenhalle aus einem massiven Eisengestell,
welches mit einer innen weiß beschichteten Plane überzogen ist.
„Wir
haben diese Konstruktion das erste Mal im Innviertel als Rinderstall
gesehen und uns gedacht, diese kostengünstige, flexible und trotzdem
langlebige Variante sei praktikabel. Wenn man alle 40 Jahre die Plane
wechselt, hält diese ewig“, erzählt Franz. Man könnte sie aber auch von
heute auf morgen wieder ohne viel Aufwand abtragen.
Früh schon
haben sich die beiden Gedanken gemacht, wie es mit ihrem Betrieb
langfristig weitergehen soll. Bereits vor dem EU-Beitritt Österreichs
konnten sie sich in Deutschland davon überzeugen, dass es mit der
Öffnung der Märkte auch einen massiven Strukturwandel in der
Landwirtschaft geben wird. Gleichzeitig hat die Region um Steyr mit
ihren Konzernstandorten wie BMW oder MAN das höchste Lohnniveau in
Österreich. Was kann man also tun, dass die Jungen überhaupt mit der
Landwirtschaft weiter machen wollen? Diese Frage stand seither im Mittelpunkt sämtlicher Überlegungen. In erster
Linie muss ein Einkommen erwirtschaftbar sein, welches mit den
Facharbeiterlöhnen in den Steyrer Betrieben konkurrieren kann.
Zusätzlich braucht es aber auch Begeisterung für den Beruf. Die Tochter
möchte später einmal den Betrieb weiterführen. Geplant ist das
Wanderreiten künftig auszubauen, verschiedene Aktivitäten für
Kindergruppen anzubieten und besonders sinnvoll erscheint der Anschluss
an das Wegenetz der Reitregion „Pferdeland Nationalpark Kalkalpen“.
Dazu
macht Cornelia bereits die Ausbildung, wobei sie immer tatkräftig von
den Eltern unterstützt wird. „Der Erhalt der Höfe ist uns ein großes
Anliegen, deshalb muss man die Jungen unterstützen und neue
Betriebszweige entwickeln“, so Familie Greil.
Eine gewisse
Schwierigkeit sieht die Familie aber für die nächste Generation, weil
sie zwei Bauernhöfe haben, die eine sinnvolle Verteilung des
Arbeitseinsatzes und des Gewinns bzw. Verlustes notwendig machen.
„Hauptübel sind heute die steigenden Energie- und Produktionskosten.
Hier braucht es eine Reglementierung und Steuerung durch die Politik“,
so der Besitzer. Denn eine Tatsache ist Familie Greil ganz klar: „Die
Pflege der Kulturlandschaft ist teuer!“ Es besteht aber große Hoffnung,
indem die Zusammenarbeit, der Austausch, Maschinengemeinschaften oder
das „Z´sammsitzen“ in der Region gefördert werden und
„Vorzeigebeispiele“ da sind.
„Die junge Generation muss im
gemeinsamen Boot sitzen und ermutigt werden. Sie sollen erfahren, dass
man nicht gleich davon läuft, sondern gemeinsam nach neuen Lösungen
sucht. So ähnlich ist die Arbeit mit den Pferden“.
Lernen soll man,
laut Familie Greil, auch von den Vorfahren, die sich bei den
Stammtischgesprächen im „Schwechater Hof“ gut vernetzten und gemeinsam
Strategien für die Landwirtschaft entwickelten.
Sie beklagten
schon den Verlust der Eigenständigkeit, weil der Staat für den Absatz
sorgte. „In den goldenen 70er und 80er Jahren ging das gut, aber der
Bauer hat alles aus der Hand gegeben und hat nicht mehr als
selbstständiger Unternehmer gedacht und gearbeitet“, so fasst Franz
Greil die Entwicklung zusammen. Heute ist Engagement und Ideenreichtum,
gepaart mit Teamgeist wieder stark gefragt, um in fairen, regionalen
Märkten bestehen zu können.
Emotion: Wie geht es Ihnen mit dem Ergebnis? Würden Sie heute etwas anderes machen; wenn ja was?
Die Familie Kleineder ist mit dem Ergebnis vollauf zufrieden, da die
Betriebsnachfolge bereits in die Bahnen geleitet wurde. Die persönliche
Überzeugung und Liebe zum Land haben die beiden augenfällig vorgelebt,
denn alle drei Kinder sind bereits voll in den gemeinsamen Betrieb
eingestiegen oder gerade am Weg dorthin. Die beiden Söhne Franz und
Andreas absolvierten die Landwirtschaftsschule in Schlierbach. Der
älteste Sohn Franz macht vorwiegend den Ackerbaubetrieb, während Andreas
und Cornelia sich voll und ganz den Pferden
verschrieben haben.